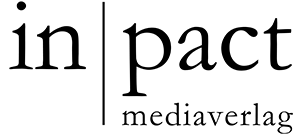Frau Weissenberger-Eibl, wie innovativ ist Deutschland?
Nach allem, was wir heute über die Innovationsfähigkeit eines Landes wissen, ist einer der wichtigsten Faktoren die Offenheit einzelner Akteure untereinander. Mit Akteuren meine ich vor allem Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Volkswirtschaften sind dann besonders erfolgreich, wenn hier ein hoher Grad von Vernetzung herrscht. Das ist in Deutschland gegeben. Der Anteil unternehmensfinanzierter Forschungen an Hochschulen ist hierzulande besonders hoch.
Aber neben dem Wissenstransfer zwischen Forschung und Wirtschaft spielen doch auch noch andere Faktoren eine Rolle, wenn wir von der Innovationskraft eines Landes sprechen, oder?
Sie haben Recht, die Innovationskraft eines Landes zeigt sich natürlich auch darin, wie staatliche Institutionen agieren, welche Stimmung in der Gesellschaft herrscht, wie der Bildungssektor organisiert ist und wie gut der Austausch zwischen all diesen Teilbereichen funktioniert. Es gibt Möglichkeiten, dies zu messen. Für den sogenannten Innovationsindikator, ein regelmäßig durch das Fraunhofer ISI und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung durchgeführtes Ranking, untersuchen wir jedes Jahr die Stärken und Schwächen Deutschlands im internationalen Vergleich. Hierfür werten wir Daten aus den hinsichtlich der Innovationsfähigkeit relevanten Teilbereichen Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Staat und Gesellschaft aus. Hier liegt Deutschland aktuell auf dem sechsten Platz.
Und mit diesem sechsten Platz können wir zufrieden sein?
Einerseits ja. Es gibt einen deutlichen Abstand zur den Spitzenreitern Schweiz und Singapur, der aber weniger dramatisch ausfällt, wenn man sich auf die reine Wirtschaftskraft konzentriert, also zum Beispiel die Investitionszahlen im Blick hat. Allerdings gibt es eben auch Teilbereiche, in denen Deutschland sich meiner Meinung nach noch erheblich verbessern kann.
Welche Bereiche sind das?
Im Zusammenhang mit dem Innovationsindikator sind es zwei Dinge, die ein wenig negativ auffallen. Zum einen kann man beobachten, dass Deutschland bei der Anzahl von internationalen Co-Patenten – also der gemeinsamen Anmeldung eines Patents von einem deutschen Wissenschaftler zusammen mit einem Kollegen oder einer Kollegin im Ausland, gegenüber anderen Ländern zurückfällt. Wenn der Rückgang auch nicht massiv ist, so sollte man diese Entwicklung dennoch im Auge behalten.
Zum anderen wird der Bereich Bildung immer wichtiger, um die Innovationskraft eines Landes zu erhalten. Wie der Innovationsindikator zeigt, liegt Deutschland hier lediglich im Mittelfeld. Bildung bleibt mit einem elften Rang der Schwachpunkt Deutschlands. Hier besteht erheblicher Verbesserungsbedarf.
Damit haben Sie einen oft geäußerten Kritikpunkt schon angesprochen: die geringen Investitionen im Bereich Bildung. Was außerdem oft bemängelt wird am deutschen Innovationsgeschehen, ist die geringe Gründungsbereitschaft.
Ja, und ich finde die Diskussion über die hierzulande angeblich nur wenig ausgeprägte sogenannte Gründermentalität auch wichtig. Auch wenn in Deutschland durchaus gegründet wird, auch wenn wir inzwischen eine Vielzahl an Instrumenten für junge Gründer zu Verfügung stellen, die kritische Startphase zu überstehen und auch wenn sich in Städten wie Berlin eine Start-up Szene entwickelt hat, die mittlerweile auch international Beachtung findet: die Bedingungen sind bei weitem nicht so ideal, wie wir das in anderen Ländern sehen.
Sie meinen zum Beispiel im Silicon Valley?
Also ich bin wirklich kein Freund des ewigen Blicks auf die kalifornische High-Tech-Szene als das gelobte Land, in dem eine perfekte Innovationskultur gelebt wird. Wenn wir über die günstigen Bedingungen im Valley sprechen, dann geht es vor allem um die höhere Verfügbarkeit von Risikokapital. Und hierfür gibt es viele Gründe, rechtliche, steuerliche und kulturelle. Andererseits ist auch klar: Die Begeisterung für Innovation und auch die generelle Risikofreudigkeit, die wir in der amerikanischen Gesellschaft beobachten, sind begünstigende Faktoren für eine gesunde Innovationskultur, auch in anderen Ländern.
Weil Sie gerade von Innovationskultur sprechen – wie würden Sie denn die Innovationskultur in Deutschland charakterisieren?
Das ist eine spannende Frage, weil wir hier einen grundlegenden Wandel beobachten können. In der Vergangenheit beruhte die Stellung Deutschlands im internationalen Vergleich vor allem auf dem Konzept der Technologieführerschaft: Wir stellen Produkte mit höchstmöglicher Qualität her. „Made in Germany“ wurde zu einem international erfolgreichen Label. Inzwischen werden wir international aber vor allem für unsere Kompetenzen als sogenannter „Ermöglicher“ komplexer Produktions-, Wertschöpfungs- und Veränderungsprozesse geschätzt. Deutschland kombiniert dabei wie kaum ein anderes Land die traditionellen Tugenden der Verlässlichkeit und Genauigkeit mit Schnelligkeit und Flexibilität. Was wir sehen, ist die Transformation eines Produktanbieters zum Serviceanbieter, den Wandel von „made in Germany“ zu „enabled by Germany“.
Ist Deutschland hierbei auf einem guten Weg?
Ja, aber die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft ist kein Selbstläufer. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Innovationen und Innovationsprozesse gestalten sich in zunehmendem Maße komplex und verlangen eine hochgradig interdisziplinäre Herangehensweise. Die Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung müssen sich noch viel stärker vernetzen. Innovationen bedürfen kreativer Freiräume, um sich entfalten zu können. Hierfür müssen dringend Infrastrukturen geschaffen werden, die technische und soziale Elemente neu verknüpfen. Und schließlich müssen wir lernen, auf kreative Weise mit einem generellen Mangel an Ressourcen umzugehen.
Sie meinen die schwindenden mineralischen Rohstoffe?
Ja. Zunächst ist es entscheidend, eine grundlegend andere Haltung zu unserem Ressourcenverbrauch zu entwickeln. Wir müssen ihn gewissermaßen abkoppeln von unserer Idee von Lebensqualität und Wohlstand. Das soll nicht heißen, in Zukunft automatisch auf immer mehr Dinge zu verzichten. Entscheidend ist es nur, zu verstehen, dass mehr Wohlstand nicht automatisch einen höheren Ressourcenverbrauch bedeutet. Aber mit Ressourcenknappheit ist eigentlich weit mehr als ein Engpass an materiellen Rohstoffen gemeint.
Sondern?
Wir werden es nicht nur mit Engpässen im materiellen, sondern vor allem im immateriellen Bereich zu tun bekommen. Ich meine damit die Ressourcen Qualifikation und Aus- und Weiterbildung. Die technologische Entwicklung schreitet immer schneller voran. Ein erfolgreicher Innovationsprozess beinhaltet aber die sinnvolle Interaktion zwischen allen beteiligten Akteuren. Genauso wichtig wird es deshalb sein, auch das Bildungsniveau an die immer höhere Geschwindigkeit anzupassen. Die Menschen müssen ja auch fähig sein, mit all der Technik, die sie umgibt, sinnvoll umzugehen. Was wir brauchen, ist ein Gleichklang von Technologieschnelligkeit, Bildungsniveau und Inhalten.
Und genau hieran müssen wir, wenn ich Sie richtig verstehe, noch arbeiten?
Ja. Und der Prozess ist ja schon im Gange. Das zeigt auch, wie intensiv gerade über die sozialen Implikationen technologischer Innovationen diskutiert wird. Die Automatisierung industrieller Produktion wird vieles einfacher machen, aber sie wird eben auch den Arbeitsmarkt ganz grundsätzlich verändern. Was bedeutet das für den einzelnen Mitarbeiter? Wird er seinen Job verlieren? Oder kann er sich weiterbilden und wenn ja, in welcher Form? Wie müssen wir Begriffe wie Diversity oder Work-Life-Balance unter diesen Bedingungen neu denken? Auf all diese Fragen sollten wir baldmöglichst gute Antworten finden.
Marion Weissenberger-Eibl (*1966 in Deutschland) ist Leiterin des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und Professorin für Innovations- und TechnologieManagement am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).